Esther Kinsky: Hain
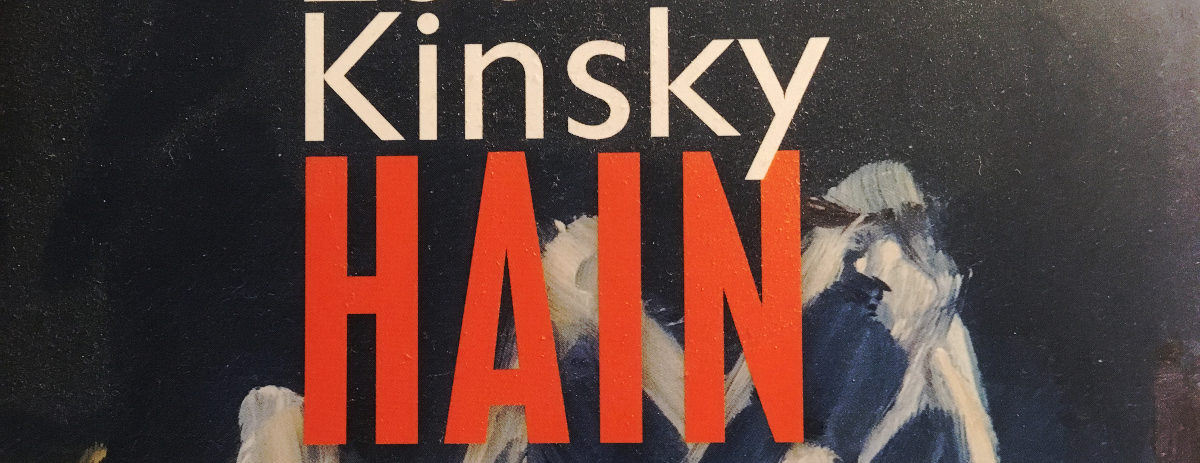
1
Ganz am Ende, als sie vor der Abreise in Comacchio ihre Koffer packt, findet Esther Kinsky in einer Seitentasche einen Negativstreifen. Sie erkennt M., ihren verstorbenen Ehemann, sofort. Doch sie braucht eine Weile, um Tag, Ort und Umstände der Aufnahmen zu rekonstruieren. Erst schemenhaft, dann konkreter, schließlich mit jener Schärfe, die den Beschreibungen der Autorin eigen ist, treten die Erinnerungen hervor: die Themse, das Licht, die Landschaft, die Bäume. "Ich hielt die Negative immer wieder hoch ins Licht und las in den dünnen weißen Kritzeln der Baumreihe in England, entzifferte die Augenblicke der Vergangenheit, bis diese Schrift der winterlich aufstrebenden Zweige der von Ferne an Federn erinnernden Bäume wie ein Wahrzeichen über diesem kleinen Kapitel aus meinem Leben mit M. stand, das sich hier wieder aufblätterte."
2
Gerahmt von zwei Meditationen über die Lebenden und die Toten (sowie, möchte man nach Lektüre von Hain hinzufügen, die Gruppe der Hinterbliebenen), ist Hain, dieser "Geländeroman" über verschiedene Italienreisen der Autorin, im Grunde nichts anderes als der immer wieder zu scheitern drohende Versuch, die Landschaften Nord- und Mittelitaliens in Schrift, in Sprache zu verwandeln, sie sprechen zu lassen und so zurück ins Leben zu finden. Die Reiseaufzeichnungen, die ins mittelitalienische Olevano, in den Hügeln nördlich von Rom gelegen, und nach Ferrara und ins Po-Delta führen, ergänzt um Erinnerungen an Reisen mit dem Vater, umkreisen zwei Leerstellen. Der Vater und der Ehemann – die beiden Toten sind auf den Wegen in diesem Buch auf uneinholbare Weise anwesend; wenn sie die Wahrnehmung der Autorin prägen, dann eben nicht, indem sie sie trüben, sondern bis in die äußerste Bewusstheit schärfen. Das Handwerk der Fotografie muss sich die Hinterbliebene in Olevano mühsam zurückerobern – der fotografische Blick hingegen ist ihren Zeilen eingeschrieben.
3
Die Erschütterung liegt erst zwei Monate zurück, als die Autorin im Winter nach Olevano kommt. Sie bewohnt dort ein Haus zwischen Friedhof und Dorf, das Ausgangspunkt zahlreicher Erkundungen sein wird. "Für den Hinterbliebenen bestimmt sich die Welt durch Abwesenheit." Die Schritte führen durch fremdes Terrain, Landschaften, Ansichten, Situationen werden detailgenau aufgezeichnet. Die vermeintlich abweisende, unwirtliche Welt wird in zahlreichen Tableaus – vom Close-Up bis zum Panorama – festgehalten. Begegnungen sind selten, Menschen, wenn sie denn vorkommen, sind meist Teil der geschaffenen Bilder. Einem Landvermesser gleich bewegt sich die Autorin von Ort zu Ort, nimmt Maß, findet Strukturen, schafft ein Bild. Auf die existenzielle Erschütterung folgt der Versuch, eine Ordnung – wo nicht zu stiften – da zu finden. Hain, diese fast pedantische Inventur des Vorgefundenen, ist Protokoll einer Neuvermessung der Welt und Versuch einer Wiederaneignung im Angesicht des lähmenden Nichts.
4
Die Koordinaten dieser Vermessung: Lebende – Tote, Vergangenheit – Zukunft, Tag – Nacht, Traum – Wirklichkeit. Immer wieder steht die Autorin vor / auf Friedhöfen, durchgehend erweist sich die Ordnung der Lebenden als begrenzt, durchkreuzt von der Anwesenheit der Toten. Verfolgte ihren Vater eine Leidenschaft für die Nekropolen der Etrusker, so ist es Kinsky's Thema, in knapper, um höchste Genauigkeit bemühter Sprache eine Topographie zu entwerfen, in der Lebende und Tote in einer eigenen Ordnung aufeinander bezogen sind. Die Abwesenheit fordert in den von Esther Kinsky vorgefundenen oder beschriebenen Landschaften stets ihren Raum ein. Etwa wenn sie anlässlich einer Zugfahrt von Ferrara nach Codigoro beschreibt, wie die Dörfer und Friedhöfe getrennt zu beiden Seiten der Bahnlinie liegen - mit entsprechenden Konsequenzen: "Immer würden die Trauerzüge so geplant werden müssen, dass kein Zug sie auf dieser allerdings wenig befahrenen Strecke unterbrach, oder die Trauergäste ... waren darauf eingestellt, an einem Bahnübergang aufgehalten zu werden, dessen Schranken sich mit blechernen Schellen senkten."
5
"Das schwere Herz wurde zu meinem Zustand in Olevano." Bei einem Blick in ein Café findet die Autorin das, was sie über weite Strecken dieser winterlichen Reisen vermisst: Wärme und Leben – das, was sie aus ihrer Kindheit in Italien zu erinnern meint. Mitten in Comacchio, "dieser verloren-verlassenen kleinen Stadt im Po-Delta tat sich mit der Sportbar ein Fenster in eine aus der Ferne vertraute, mir nicht einmal zugängliche, nur von Männern frequentierte Welt der Kneipe auf und tröstete mich kurz über etwas hinweg, das ich beim Wandern durch die norditalienischen Straßen in diesen Wochen vage und unbenannt als Abwesenheit und Verlust spürte."
Was die Autorin selbstbewusst mit der Gattungsbezeichnung "Geländeroman" versieht, es ist mitnichten ein verlässlicher Reisebegleiter durch Italien – so wenig wie eine Fotokamera die Realität objektiv abbildet. Der Blick auf das hier beschriebene Gelände ist von bestürzender Subjektivität, die durch ihre Genauigkeit besticht und somit zum genauen Hinschauen einlädt.
Wer das Blau inmitten der zahlreichen Grautöne dieser Reisebeschreibungen vermisst (gleichwohl: es gibt es), dem hält die Autorin – einer Entschuldigung, einer Warnung gleich – die Beschreibung eines Bildes von Fra Angelico entgegen, einem
Bild der Trauer, auf dem das blaue Dreieck über den Türmen und Mauern des Klosterhofes niemandem im Bild ins Auge fällt und niemandem etwas bedeutet, es hängt wie eine kleine Pflichtübung dort am oberen Rand, der kostbare Lapislazuli wurde umsonst mühsam gewonnen und zu Pulver gestoßen, er gereicht zu keinem Trost in der Hinterbliebenschaft.