Was wir wissen können
Handelte es sich bei dem letzten an dieser Stelle besprochenen Roman, Fiona Sironics Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft, um eine Art Flaschenpost aus der Zukunft – hermetisch ab- und kunstvoll verdichtet – so steht in Ian McEwans neuem Roman eine Flaschenpost in die Zukunft im Mittelpunkt.
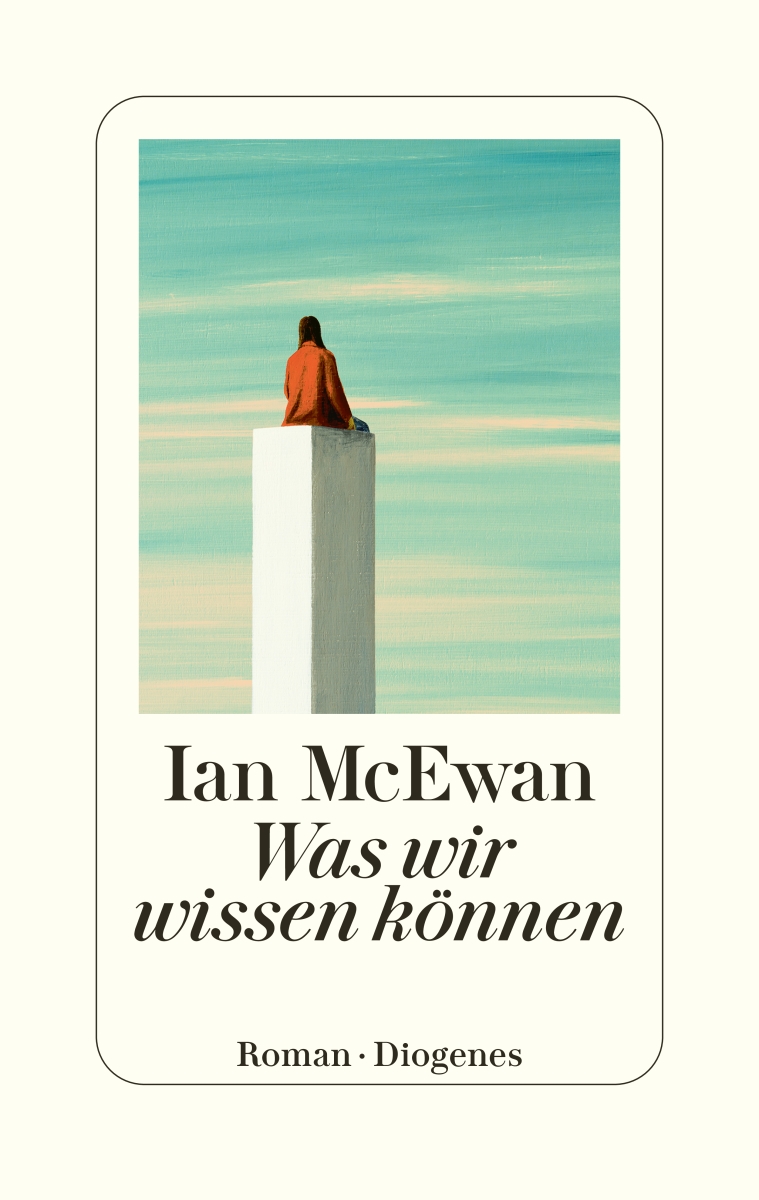
Gleich zu Beginn katapultieren uns die Aufzeichnungen des Literaturwissenschaftlers Thomas Metcalfe ins Jahr 2119. Die Welt, die hier in aller Selbstverständlichkeit und Beiläufigkeit geschildert wird, hat mit unserer nicht mehr allzu viel gemein – umso mehr aber dreht sich das ganze Forschen und Denken des Wissenschaftlers und seiner Partnerin (und bald Frau) um die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts: Unsere Gegenwart ist aus der Perspektive derer, die das 21. Jahrhundert überlebt haben, eine fremde und ferne Welt.
Die Flaschenpost, die Metcalfe zu finden sucht, ist ein Sonettenkranz, den der Dichterfürst Francis Blundy an einem Abend im Jahr 2014 seiner Frau Vivien zum Geburtstag vortrug. Nie veröffentlicht, muss er wohl als verschollen gelten. Für Kenner ist das ungelesene Meisterwerk ein Höhepunkt im Schaffen des angesehenen Dichters.
Die Aufzeichnungen aus den Jahren 2119 und 2120, die den ersten Teil von Was wir wissen können ausmachen, versprechen ein schillerndes Lesevergnügen. Die Katastrophen, die im Jahrhundert davor die Welt erschütterten, werden nur im Vorbeigehen erwähnt. Man hat sich scheinbar daran gewöhnt, dass England ein Archipel einzelner, teilweise nur unter Lebensgefahren erreichbarer Inseln geworden ist. Die Rede ist von „der Disruption“. Dahinter verbergen sich nicht nur Klimawandel und Anstieg des Meeresspiegels:
“Entscheidender aber die Nuklearpolitik Mitte des 21. Jahrhunderts und das fatale Konzept eines ‚begrenzten‘ Atomkriegs, eine russische, fehlerhaft konstruierte Interkontinentalrakete, auf den Süden der Vereinigten Staaten gerichtet, die mitten im Atlantik explodierte und katastrophale Tsunamis auslöste, mit verheerenden Folgen für Europa, Westafrika und die Küsten Nordamerikas. … Jede Menge verschwundener Städte. … Die weltweite Ökonomie und ihre Verteilungsnetzwerke zusammengebrochen.“
Nigeria ist zur Weltmacht aufgestiegen, Europa in der Bedeutungslosigkeit (und im Meer) versunken. Lieferketten und Märkte funktionieren wieder wie in vormodernen Zeiten,, Wissenschaft und Bibliotheken sind – zur Sicherung des Erbes – auf Berge gezogen. Die Geisteswissenschaften und die Literatur fristen – nach einer Hochphase zur Zeit der Klagegesänge im 21. Jahrhundert – ein Schattendasein.
Metcalfe lebt in einer Kunstwelt, ausstaffiert mit allem, was er aus analogen Aufzeichnungen, digitalen Quellen, Kommunikationsdaten und Veröffentlichungen über das Objekt seiner Begierde, den Dichter Francis Blundy in Erfahrung bringen kann. Er schreibt in einer kunstvollen, anspielungsreichen Sprache, die angesichts der allumfassenden Katastrophe von Schönheit und Bildung kündet. Nur dass es niemanden mehr gibt, den das so recht interessiert. Metcalfes Jagd nach den verschollenen Gedichten, allen Umständen und Hindernissen zum Trotz, gerät Ian McEwan zunehmend zum Pageturner – allzumal der britische Dichter alle Register der literarischen Tradition bis hin zum Abenteuerroman zieht.
Es braucht eine riskante Expedition auf das kaum begehbare Eiland, auf dem der alte Hof des Dichters und seiner Frau liegt, um fündig zu werden. Doch was Metcalfe und seine Frau unter Einsatz ihres Lebens finden, ist keineswegs der kunstvolle Sonettenkranz, von dem die Bewunderer des Dichters schwärmten. Es sind „Die Bekenntnisse von Vivien Blundy“, die als Roman im Roman den zweiten Teil von McEwans Werk ausmachen. Die Frau des Dichters tritt aus dem Schatten des vermeintlichen Genies – „was für ein furchterregender Kerl“, schreibt sie irgendwann – hervor. Ihre Bekenntnisse stellen auf den Kopf, was bis dahin über Blundy bekannt war.
Verraten sei nur so viel: McEwan verfasst eine süffisante Parodie über den Kultur- und Literaturbetrieb unserer Zeit, die Ehedrama und Kriminalfall zugleich ist. Der fast tragikomisch anmutende Reigen aus Seitensprüngen und Affären, der in dieser Flaschenpost steckt, stammt aus einer Welt, die rückblickend noch ziemlich in Ordnung war – nur ziemlich blind für ihre Widersprüche und ihr Scheitern. Ob das zukünftige Generationen besser hinbekommen?