Autobiographisches
in den Romanen von Olivia Wenzel und Christoph Peters
Neulich auf einer Schreibwerkstatt anlässlich des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung: da trafen sich verschiedene Generationen aus Ost und West, um miteinander Geschichten auszutauschen, sich in Bruchstücken zu erzählen, wo man herkommt, wie man wurde, wer man ist, und an welchen Kreuzungen sich die eigene Geschichte entschied. Spannend war das wie zu erwarten aufgrund der nicht selten gegenteiligen Perspektiven und der so unterschiedlichen Geschichten, die daraus erwuchsen.
Etwas ähnliches lässt sich erleben, liest man nacheinander zwei autobiographisch geprägte Romane, die dieses Jahr erschienen sind und – jeder auf seine Weise – auch ein Stück Zeitgeschichte des jeweiligen Landesteiles transportieren. Christoph Peters kehrt in seinem zumindest auf den ersten Blick recht konventionell erzählten Dorfroman in das tief in Westdeutschland gelegene Dorf seiner Kindheit zurück, während Olivia Wenzel die Brüche zwischen DDR-Zeit, Nachwendegesellschaft und Gegenwart in ihrem Roman-Debüt 1000 Serpentinen Angst auch formal zum Thema macht.
1000 Serpentinen Angst

Wenzel, 1985 in Weimar geboren, hat in Hildesheim Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis studiert und ist bisher eher als Theaterautorin in Erscheinung getreten. Das merkt man auch ihrem Roman an. Über weite Teile ist er in Dialogform geschrieben, in einer Mischung aus Selbstgespräch und Verhör; anstelle einer Handlung kreist der Roman in kurzen Szenen oder gar Splittern um seine Themen: Ausgrenzung, Ohnmacht, Fremdheitsgefühle, Verzweiflung.
So ermüdend ich die Form des Romans auf Dauer fand, so prägnant sind dann doch wieder einzelne Szenen, so relevant ist die Art, wie sich Wenzel ihrem Thema nähert. Die Erzählerin ist das farbige Kind einer Punkerin in der DDR, die gern ausreisen möchte, dem angolanischen Vater ihrer Kinder hinterher, stattdessen im Knast landet: eine Ansammlung von Klischees?
"Das Problem mit Klischees ist nicht, dass sie nicht stimmen," heißt es im Roman. Auch in meiner Familie gibt es "Knast-Erfahrungen", gibt es Brüche, die kleingeredet oder weggeschwiegen werden: Die Klischees, sie stimmen ziemlich oft. Ines Geipel hat darüber zuletzt sehr eindrücklich geschrieben. In Serpentinen, in Spiralen arbeitet sich die Erzählerin im Roman an ihrer Gegenstimme ab, an den Klischees, an den Rissen in einem Leben, in dem wenig dafür zu sprechen scheint, dass es gelingen mag. (Selbst der Hoffnungsschimmer am Ende wirkt wie ein geborgtes Klischee.)
Was folgt: Anderssein und Ausgrenzung in der DDR, Selbstmord des Bruders, Fremdheitserfahrungen als Farbige in der deutschen Gesellschaft, Momente der Freiheit in Amerika, in Deutschland dann aber wieder die einzige Schwarze in einem vollen Kinosaal, Neonazis in Brandenburg, "#Baseballschlägerjahre" nicht nur in den 90ern, Beziehungsprobleme, Depressionen, Angstzustände, Psychotherapien ...
Als kleines Kind habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht als eine Creme, eine wundersame Salbe, die ich vor dem Zubettgehen auftragen und die mich über Nacht weiß machen würde.
Wie allgegenwärtig Diskriminierung im 21. Jahrhundert ist und was das mit den Opfern macht: das beschreibt Olivia Wenzel eindringlich in diesen Kreisen, die ihre Erzählerin fast zwanghaft um ihre Geschichte dreht. Gleichzeitig gibt die Autorin ihr eine eigene Sprache und eine (sub-) kulturelle Informiertheit, so dass 1000 Serpentinen Angst auch einen Ausweg aus der Spirale erweist, eine Idee von Freiheit – hin zur Handlungsfähigkeit.
Dorfroman
Im Grunde bestätigt auch Christoph Peters' Dorfroman ein Klischee: dass es "im Westen", bei allen Verwerfungen dennoch eine Kontinuität gegeben hat, die im Zweifel stärker ist als alle Risse, die sich durch Biographien oder Familien ziehen.
Deshalb ist auch ein – im Vergleich zu Wenzel – fast gediegenes, konventionelles Erzählen möglich, das schon im Titel angedeutet wird: der Dorfroman ist Entwicklungsroman, Gesellschaftspanorama, Chronik gleichermaßen. In 30 Kapiteln, mit einer ruhigen, unaufgeregten Erzählweise spannt Peters den Bogen zwischen einer Kindheit im Westdeutschland der 1970 und der Gegenwart, in der der mittlerweile in Berlin lebende Erzähler nach Hülkendonck, in das Dorf seiner Kindheit, zurückkehrt.
Als mein Vater unser Haus gebaut hat, war er überzeugt, ein Geschlecht zu begründen, dem eine bessere Zukunft als seine eigene zwischen Pferdepflug, Schweinescheiße und Krieg offenstünde. Seine Kinder würden die höhere Schule besuchen, Jura oder Medizin studieren, als Anwälte, Notare, weithin respektierte Ärzte gutes Geld verdienen. Eines Tages träte einer von uns seine Nachfolge an, übernähme den Stammsitz, die Gärten, während meine Mutter und er sich im ersten Stock aufs Altenteil zurückzögen, nach vollbrachter Lebensleistung ihren verdienten Ruhestand im Kreis von Enkeln und Urenkeln verbrächten. ... Nichts von alledem ist eingetreten.
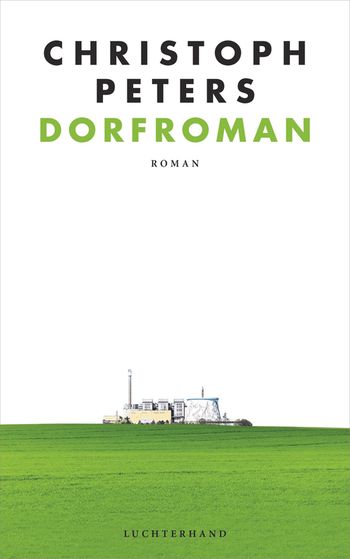
Der Rückblick, der aus dieser Heimkehr – und der Frage danach, ob man sich hier, bei den Eltern, wieder niederlassen könne – resultiert, bringt Verschiedenes zutage. Da ist zum einen der langsam einsetzende Zerfall der dörflichen Welt, der Einzug der Industrie in die Landwirtschaft, die Verstädterung auf dem Lande. Peters schreibt auch eine Art Nachruf auf eine Welt, die sein Erzähler schon nicht mehr findet. Da ist aber vor allem der Bau des Schnellen Brüters, der den Ort und die Familie spaltet. Nicht nur der Kirchenvorstand zerbricht an den Verhandlungen – der Dorfroman legt auch Zeugnis ab über die Art und Weise, wie sich die (katholische) Kirche angesichts moderner Lebensfragen selbst demontiert. Und dann ist da natürlich noch Juliane, die erste große Liebe des Erzählers, die diesen nicht nur in sexuelle, sondern vor allem auch in neue politische Sphären einführt ...
Der Kunstgriff, der Peters' Dorfroman so außergewöhnlich wie bemerkenswert macht, ist dabei, dass der Roman Kapitel für Kapitel fast spiegelbildlich zwischen zwei Perspektiven wechselt. Aus der Zeit vor dem Bau des Atomkraftwerks erzählt aus nächster Nähe das kindliche Alter Ego des Erzählers. Die Welt ist noch heil: was die Eltern sagen, ist erstmal per se überzeugend, die Kirche ist ein fixer Orientierungspunkt im Alltag, und all das, was das Verständnis des Kindes übersteigt (Baader-Meinhof, der WDR, der Papst), wird in den kindlichen Kosmos so eingeordnet, dass es passt.
Dem gegenüber stehen die Erinnerungen des erwachsenen Erzählers, der auf seine Jugendzeit zurückblickt. Das AKW ist gebaut (wenngleich es nie ans Netz gehen wird), die Fronten im Dorf, die sich im kindlichen Blick wie in einem Spiel gerade erst bilden, sind längst verhärtet, und die Gegenkultur (lange Haare, Drogen, freie Liebe) hat ihr Widerstandsnest in Sichtweite des Schnellen Brüters aufgebaut. Die Erinnerungen gelten der Jugendzeit, der eigenen Politisierung – und dem Moment, wo sich der Bruch zwischen Eltern und Kind ereignete. Das Behütetsein der Kindheit vermögen sie nicht einzuholen.
Zwei Erinnerungsschichten, die sich diametral gegenüberstehen und dennoch beide ihre Gültigkeit, ihr Recht behalten: die Stärke seines Dorfromans liegt darin, wie Christoph Peters dem so unterschiedlichen Erleben des Kindes / des Jugendlichen seine je eigene Wahrheit zugesteht. Und wie er den Riss, der sich in dieser Biographie verbirgt, ohne ihn zu kitten dennoch zu überbrücken vermag. Der Erzähler wird, soviel sei verraten, nicht wieder zu seinen Eltern ziehen. Versöhnung über alle Verwerfungen hinweg stiftet dieser Roman aber in mehr als ausreichendem Maß.