Tage in Tokio
Sich in der Literatur zu bewegen, von Buch zu Buch, von Autor zu Autor Spuren zu verfolgen und so ein Bücher und Leben umspannendes Netz zu spinnen, ist verlockend: das eigene Leben gewinnt so an Kontur und Tiefe. Auch der Dialog zwischen Büchern verschiedener Autoren eröffnet spannende Einsichten. So teile ich mit Frank Berzbach (Die Kunst zu lesen) die Liebe zum Tee und das Interesse am Zen-Buddhismus, was mich wiederum schon vor langer Zeit zu den Büchern von Christoph Peters (Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln) geführt hat – dessen Buch über den Tee (Diese wunderbare Bitterkeit) auch in Berzbachs jüngst erschienenem Literaturverführer auftaucht.
Berzbach, der sich wie Peters seit Jahren mit japanischer Kultur beschäftigt, kam bei der Lektüre klassischer japanischer Texte über die Liebe zu dem Schluss:
"Ich bin kein Japaner! Meine Vorliebe für die japanische Ästhetik, die Welt des Tees und der Zen-Buddhismus haben zeitweise zu einer gewissen Idealisierung geführt."
Soll man die eigene Vorstellung von der fremden Kultur also besser von der Realität verunreinigen lassen?
Christoph Peters schreibt seit 35 Jahren über Japan: die Tee-Zeremonie, die Keramik-Kunst, die Yakuza sind immer wiederkehrende Motive in seinen Büchern – doch er selbst kennt Japan (Überraschung!) nur aus Filmen, Büchern und Google Streetview. Er war nie dort – bis vor kurzem. Über seinen ersten Aufenthalt in Tokio, als Writer in Residence an der Keiō-Universität, hat er nun einen schmalen Band mit Beobachtungen und Reflexionen veröffentlicht, minimalistisch illustriert von Matthias Beckmann. Er trifft (zweite Überraschung!) auf eine gar nicht so fremde Kultur ...
Wahrnehmung und Projektion
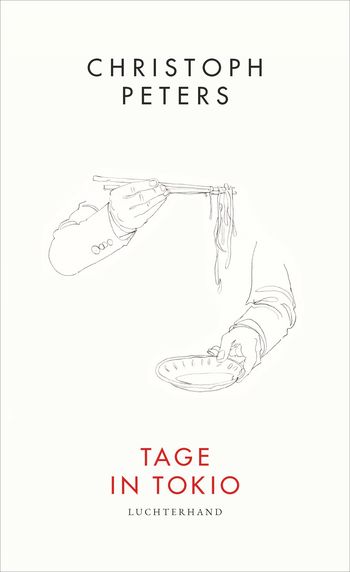
Ein Deutscher in Japan – das kennt man ja aus den Filmen von Doris Dörrie – ist mit Sicherheit ein Garant für slapstickhafte Komik und ein paar treffsichere Pointen! Soweit die eigene Erwartungshaltung – und auch die wird (Gott sei dank) enttäuscht: Der Humor bei Peters ist eher sehr leise und subtil; seine Beobachtungen sind Anlass zur tiefgründigen Reflexion über die Begeisterung für fremde Kulturen, die Projektionsfläche des Exotismus und die Fremdheit des Eigenen. Denn tatsächlich findet Peters die essentiellen Bestandteile seines an Zen-Praxis und Teeschalen entwickelten Japan-Bildes in der Realität zunächst nicht wieder: in Tokio steckt ebenso viel Berlin wie Bielefeld.
Zen und Rauch
Dennoch: das "Japanbild" aus Zen und Tee hält sich beständig. Bevor der Autor aber am Ende des Buches einen Zen-Tempel aufsucht (der natürlich in nichts seiner Vorstellung entspricht), besucht er das älteste Kaufhaus der Welt – und den Raucherbereich an der Seitenstraße. Nicht ohne schlechtes Gewissen. Rauchen ist in Tokio nicht nur in Hotels und öffentlichen Gebäuden undenkbar, auch auf der Straße sei es wegen der Olympischen Spiele verboten, wird er von seiner Gastgeberin aufgeklärt. Es bleiben spezielle Raucherplätze. Der erste Gang in Tokio führt Christoph Peters
"also weder in einen wichtigen Zen-Tempel, noch in ein bedeutendes Museum, nicht einmal in eine Sushi-Bar oder ein Teegeschäft, sondern zu einem schäbigen Rauchplatz in der Seitenstraße, der mir unmissverständlich vor Augen führt, dass ich keineswegs ein weltreisender Genussmensch bin, sondern schwach, um nicht zu sagen suchtkrank."
Das entbehrt natürlich nicht der Komik – allzumal Peters Trost findet: Auch mancher Zen-Meister war bekannt für seinen Tabak-Konsum. Nichts ist so einfach, wie es scheint.
Alltag und Keramik
Peters versteht es meisterhaft, in größter Pedanterie der Unsicherheit und Befangenheit nachzuspüren, die diese Erstbegegnung mit der fremden Kultur kennzeichnen. Lost in translation bewegt er sich immer wieder verwundert durch die Straßen der Metropole – und entwickelt so ein Auge für die leisen Zwischentöne des Alltäglichen. Und dann ist da Besuch im Suntory-Museum, versteckt in einer Einkaufspassage: Wer einmal in aller Kürze Grundlegendes über das japanische Keramik-Handwerk erfahren möchte, lese die Seiten über das Museum.
Denn was auf einen kleinen historischen und philosophischen Exkurs über die japanische Keramik folgt, hat Züge einer Epiphanie: Vor einer Schale aus dem Jahr 1590, die Peters schon von diversen Abbildungen kennt, erfährt er den Unterschied zwischen Bild und Wirklichkeit.
"Weshalb nun gerade diese Shino-Chawan alle anderen überragen sollte, hat sich mir nie erschlossen. Jetzt ist alles anders."
Seitenlang beschreibt Peters auf beeindruckende Weise, welche Schönheit, welche Einzigartigkeit ihm in dieser Schale begegnet. Es sei, so schreibt er, "ein einmaliger Augenblick, darin vollkommenes Glück und der äußerste Schmerz". Die Schale hat einen Wert von mehreren 100.000 Dollar. Man sollte wohl mal nach Tokio fahren und sich das (und einiges andere) selbst anschauen.