Sekunden der Gnade
“Ich bin mitten in einer sehr rassistischen Gesellschaft aufgewachsen“,
sagt Dennis Lehane und zeigt sich wenig überrascht vom aktuell überall auf der Welt wieder aufbrechenden Rassismus. Für seinen neuesten Roman, Sekunden der Gnade, reist er zurück ins Jahr 1974 – und hält der Gegenwart gleichsam einen ernüchternden Spiegel vor. Die Geschehnisse in Boston in jenem Sommer, bis hin zu brennenden Politikerbildern, kommen einem merkwürdig bekannt vor. Wie da aufgebrachte Eltern gegen einen Bustransfer zwischen bis dato nach Rassen getrennten Schulen protestieren, scheinen „Wutbürger“ und Querdenker nicht weit entfernt; gestern wie heute verteidigen Menschen ihren „Phantombesitz“ (Eva von Redecker) an vermeintlicher Freiheit – die erst verteidigenswert wird, wenn sie einem von anderen gesellschaftlichen Gruppen oder „denen da oben“ genommen werden soll.
“Es sei gegen Gottes Plan, der Menge, einem Stadtteil, einer Kultur, einem Ort des Stolzes und der Ehre Veränderungen aufzuzwingen, um denjenigen entgegenzukommen, die zu schwach oder zu faul sind, sich selbst zu helfen.“
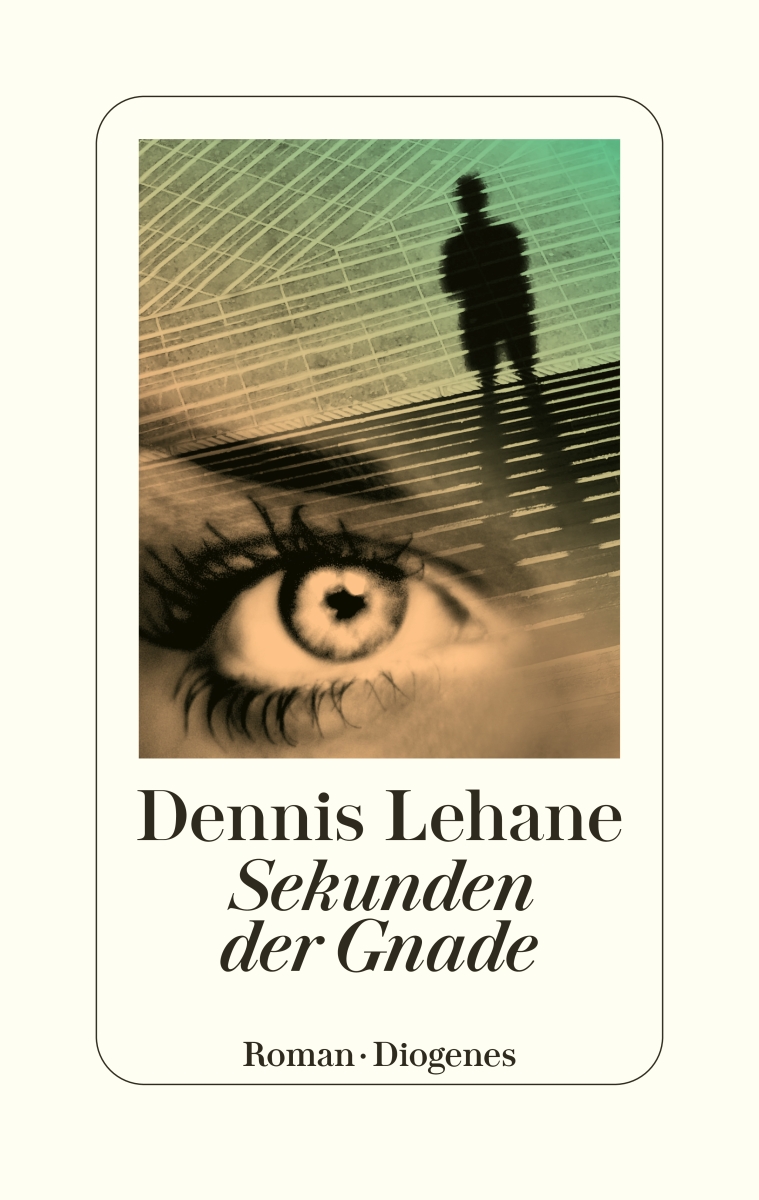
Kurz: So sehr der Roman in das Zeitkolorit der 1970er eintaucht, so gering ist doch letztlich die historische Differenz.
Sekunden der Gnaden spielt vor dem Hintergrund mächtiger Unruhen in der Bostoner Stadtgesellschaft, nachdem eine richterliche Entscheidung die Stadt zwang, mit Bussen schwarze Schüler an weiße Highschools und umgekehrt zu fahren. „Es war sehr heiß in Boston in diesem Sommer“, heißt es in einer einleitenden historischen Notiz – und Lehane hält mit dem Vergrößerungsglas drauf auf einen Brandherd, der sich im Laufe der Geschichte durch die halbe Stadt wälzen wird. Im Mittelpunkt steht Mary Pat Fennessy – Witwe, weiß, definitiv alles andere als wohlhabend, doch dafür mit einem mehr als eigenwilligen Überlebensinstinkt ausgestattet. Wie man so wird mit einem Sohn, der an einer Überdosis gestorben und zwei Männern, von denen einer gestorben und der andere sie verlassen hat. Mary Pat positioniert sich zu Beginn eigentlich ganz eindeutig im Lager der weißen Mittelschicht und tritt für die Beibehaltung der Rassentrennung an den öffentlichen Schulen. Man möchte ja nicht noch mehr benachteiligt werden. Dafür aber kann sie sich „nützlich machen“ und gegen die Tyrannei durch die Politik kämfen:
“Die da oben schreiben ihr vor, wo sie ihr einziges Kind zur Schule schicken soll. Auch wenn das die Bildung des Kindes und sogar sein Leben gefährdet.“
Das alles aber wird bald das kleinste Problem für Mary Pat sein. Während ein schwarzer Jugendlicher auf einem Bahnhof von einem Zug überrollt wird, verschwindet ihre pubertierende Tochter. Zunächst wartet Mary Pat. Dann beginnt sie zu suchen. Doch irgendwann wächst die Gewissheit, dass die beiden Fälle miteinander zu tun haben – und das ihre Tochter nicht wiederkommen wird. Aus den Ermittlungen auf eigene Faust, bei denen Mary Pat auf sich allein gestellt ist (obwohl die Polizei in diesem Roman durchaus positiv gezeichnet ist), wird bald ein blutiger Rachefeldzug:
“Du hast meine Familie ermordet“, sagt sie leise in der Stille der Garage. „Dafür bringe ich deine um“, verspricht sie ihm.
Das sich zuspitzende Geschehen in den Bostoner Straßen nimmt einem zunehmend den Atem. Das liegt vor allem an der Protagonistin dieses Romans: Mary Pat steckt voller Widersprüche, so dass man ihr bei allem Verständnis und Anteilnahme dennoch nicht über den Weg traut. Ihrem Weg in die Vereinzelung folgt man dennoch ohne Zögern. Indem sie zwischen die Fronten, zwischen Schwarz und Weiß gerät, lösen sich die Gegensätze auf, die feindlichen Linien bröckeln.
“Menschen schließen sich immer nach Prinzipien zusammen. Prinzipien, die nichts mit Liebe zu tun haben, Prinzipien, die sie von persönlicher Verantwortung entbinden,“
heißt es bei James Baldwin. Solange das so ist, solange sich Menschen gegenüberstehen, um ihre Identität in der Abgrenzung von anderen zu festigen, wird es Geschichten wie diese von der verzweifelten Mutter geben, die völlig sinnlos zwischen die Fronten gerät.